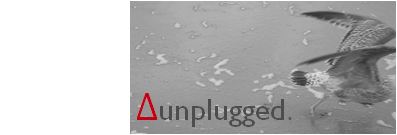... newer stories
Freitag, 25. Dezember 2015
okavanga, 23:58h
Mama, warum hast du dich eigentlich noch nicht umgebracht? Was hat dich abgehalten? Oder: was hat dich gehalten? Diese Fragen gehen mir durch den Kopf, wieder und wieder, als ich durch den Nieselregen laufe. Weglaufe von der Familienweihnacht beim Vater, weglaufe vom Sitzen, Essen, Bescheren. Weg von mir selbst. Von meinem Neid, meiner Missgunst. Meiner Traurigkeit. Ich wähle meine Strecke durch den Waldpark beliebig, so glaube ich. Irgendwann wird mir bewusst, dass ich wenn auch auf Umwegen, so doch ohne Zweifel auf den Turm zusteuer. Ich will unbedingt auf den Turm. Von dort oben kann man die ganze Stadt sehen. Der Tag gibt der Nacht bereits die Hand, aber hell ist an diesem ganzen ersten Weihnachtsfeiertag nicht geworden. Es ist diesig, nasskalt, durch kleine Wassertropfen auf der Brille zerlaufen die Bäume. Während ich auf den Turm zugehe, sehe sich wie aus der anderen Richtung zwei Menschen annähern. Sie erreichen den Turm, zücken eine Taschenlampe, machen sich auf den Weg nach oben. Ich will nicht mit anderen Menschen dort oben sein und beschließe eine Schleife zu drehen. Was willst du denn da oben, frage ich mich. Weiß nicht. Mal runterschauen? Aha, ist das alles? Es kostet mich viel Anstrengung mich nicht auf die Suche nach dem notwendigen Mut zu begeben. Als ich mit der Schleife fertig bin, höre ich laute Stimmen vom Turm, sie rufen nach unten, andere antworten. Geh nach Hause, denk ich mir. Es soll heute nicht sein.
Inzwischen ist es dunkel. Auf dem Friedhofparkplatz vor dem Krematorium steht nur noch ein anderes Auto. Ich weiß nicht, ob Sie in der Weihnachtszeit nachts mal auf einem Friedhof waren. Für mich ist es der friedlichste Ort der Welt. Ich wander zwischen den Gräbern hindurch, überall leuchten Kerzen und Lämpchen, weiß, rot, groß, klein. Ein Lichtermeer, still und wunderschön, zwischen Grabsteinen, Bäumen, Blumen und Kränzen, die nur noch als schwarze Silhouetten erkennbar sind. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es finde. Schon sehr sehr lange war ich nicht mehr dort, und so schön die Lichter sind, sie reichen nicht aus um Feldanzeigen und Grabinschriften zu entziffern. Und doch stehe ich plötzlich vor dem weißen marmorierten Grabstein, und traue mich endlich zu weinen. Es ist holprig, kurz, ein Kratzen an der Oberfläche. Während ich auf Ruhe warte, merke ich wie sich die Welle immer mehr aufbaut. Seit Tagen, vielleicht auch Wochen, Monaten oder Jahren, auf der Suche nach einem Strand, an den sich die Welle spülen, entladen kann. Nachdenklich und mit wachsender Unruhe fahre ich nach Hause, Angst vor dem, was kommen könnte, wenn ich es nicht schaffe mich im Griff zu haben.
Sie sind gerade auf dem Sprung. „Gehst du mit?“ Nein, ich bleibe hier. Ich setze mich aufs Sofa. Mein Vater setzt sich neben mich. Es geht dir nicht gut, sagt er. Nein, antworte ich, er nimmt mich in den Arm, aber ich bleibe steif, kann es nicht zulassen, bin zu aufgewühlt und stehe kurz vor einem Dammbruch, den ich unbedingt vermeiden will. Meine weiteren Worte kriechen wie bittere Galle aus meinem Hals, ergießen sich in das weihnachtlich beleuchtete Wohnzimmer, ätzen in die Luft ihre bodenlose Einsamkeit und Traurigkeit, verpackt in Verbitterung und Ungerechtigkeit. Verständnis kommt mir keins entgegen, stattdessen Ärger, Unmut. „Ich spreche jetzt nicht mehr mit dir weiter, das macht keinen Sinn. Ich wünsche dir trotzdem ein schönen Abend.“ Weg sind sie.
Und mit dem Luftdruck der sich schließenden Tür wird eine Tsunamiwelle von so ungeheurem Ausmaß über mich hinweggespült, dass ich meine sofort und haltlos zu ertrinken. Sie schlägt mit brutaler Wucht in und auf meinem Körper auf, schlägt über mir zusammen und reißt mich von den Füßen, hinab in eine eiskalte und unendlich tiefe See. Gnadenlos, unerbittlich, unaufhaltsam. Irgendwann kratze ich mir die Unterarme auf, helfe mit der Nagelschere nach, knurre mich selbst an wie ein rasendes Tier, bin ein rasendes Tier, heulend vor Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit und unbeschreiblicher Traurigkeit. Ich weiß nicht wohin mit mir, packe alle meine Sachen, will weg, weglaufen, diesmal wirklich, aber wohin, es ist Abend, keine Zugverbindung von mir hier würde mich auch nur halbwegs sinnvoll in meine Höhle bringen. Was soll ich tun? Ins Hotel? Ich weine und weine, ein rasender Rausch, fast wie im Wahn, ohne Halten. Wohin mit mir, wohin? Mama, denke ich irgendwann, und wähle ihre Nummer. Besetzt. Ich renne zur Nagelschere und weine noch heftiger, um mich und weil ich nicht anhalten kann. Wahlwiederholung. Besetzt. Überlege mich selbst einzuweisen, schaff es aber nicht, weiß auch wie es dort ist, und will dort nicht hin. Wohin mit mir?
Irgendwann das Freizeichen, sie klingt atemlos, „Hallo?“ Schluchzen, Stottern, ich hasse mich so, Mama, ich kann das alles so nicht mehr leben. Mama hört zu, Mama fragt, Mama erzählt. Mama kennt. Und ist doch ebenso überrascht wie ich selbst. Noch während wir sprechen packe ich meine Sachen wieder aus. Hau nicht ab wie sonst.
Zwei Stunden später kann ich aufhören zu weinen. Es ist wie runterkommen von einem krassen Crystaltrip. Die Welle zieht sich zurück ins Meer, der Wind flacht ab, Möwen kreischen. Es bleiben Staunen über das uralte angespülte Strandgut, Entsetzen. Ratlosigkeit. Erschöpfung und somit endlich so etwas wie Ruhe. Aber ich weiß, diese Flut kommt wieder.
Inzwischen ist es dunkel. Auf dem Friedhofparkplatz vor dem Krematorium steht nur noch ein anderes Auto. Ich weiß nicht, ob Sie in der Weihnachtszeit nachts mal auf einem Friedhof waren. Für mich ist es der friedlichste Ort der Welt. Ich wander zwischen den Gräbern hindurch, überall leuchten Kerzen und Lämpchen, weiß, rot, groß, klein. Ein Lichtermeer, still und wunderschön, zwischen Grabsteinen, Bäumen, Blumen und Kränzen, die nur noch als schwarze Silhouetten erkennbar sind. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es finde. Schon sehr sehr lange war ich nicht mehr dort, und so schön die Lichter sind, sie reichen nicht aus um Feldanzeigen und Grabinschriften zu entziffern. Und doch stehe ich plötzlich vor dem weißen marmorierten Grabstein, und traue mich endlich zu weinen. Es ist holprig, kurz, ein Kratzen an der Oberfläche. Während ich auf Ruhe warte, merke ich wie sich die Welle immer mehr aufbaut. Seit Tagen, vielleicht auch Wochen, Monaten oder Jahren, auf der Suche nach einem Strand, an den sich die Welle spülen, entladen kann. Nachdenklich und mit wachsender Unruhe fahre ich nach Hause, Angst vor dem, was kommen könnte, wenn ich es nicht schaffe mich im Griff zu haben.
Sie sind gerade auf dem Sprung. „Gehst du mit?“ Nein, ich bleibe hier. Ich setze mich aufs Sofa. Mein Vater setzt sich neben mich. Es geht dir nicht gut, sagt er. Nein, antworte ich, er nimmt mich in den Arm, aber ich bleibe steif, kann es nicht zulassen, bin zu aufgewühlt und stehe kurz vor einem Dammbruch, den ich unbedingt vermeiden will. Meine weiteren Worte kriechen wie bittere Galle aus meinem Hals, ergießen sich in das weihnachtlich beleuchtete Wohnzimmer, ätzen in die Luft ihre bodenlose Einsamkeit und Traurigkeit, verpackt in Verbitterung und Ungerechtigkeit. Verständnis kommt mir keins entgegen, stattdessen Ärger, Unmut. „Ich spreche jetzt nicht mehr mit dir weiter, das macht keinen Sinn. Ich wünsche dir trotzdem ein schönen Abend.“ Weg sind sie.
Und mit dem Luftdruck der sich schließenden Tür wird eine Tsunamiwelle von so ungeheurem Ausmaß über mich hinweggespült, dass ich meine sofort und haltlos zu ertrinken. Sie schlägt mit brutaler Wucht in und auf meinem Körper auf, schlägt über mir zusammen und reißt mich von den Füßen, hinab in eine eiskalte und unendlich tiefe See. Gnadenlos, unerbittlich, unaufhaltsam. Irgendwann kratze ich mir die Unterarme auf, helfe mit der Nagelschere nach, knurre mich selbst an wie ein rasendes Tier, bin ein rasendes Tier, heulend vor Wut, Verzweiflung, Hilflosigkeit und unbeschreiblicher Traurigkeit. Ich weiß nicht wohin mit mir, packe alle meine Sachen, will weg, weglaufen, diesmal wirklich, aber wohin, es ist Abend, keine Zugverbindung von mir hier würde mich auch nur halbwegs sinnvoll in meine Höhle bringen. Was soll ich tun? Ins Hotel? Ich weine und weine, ein rasender Rausch, fast wie im Wahn, ohne Halten. Wohin mit mir, wohin? Mama, denke ich irgendwann, und wähle ihre Nummer. Besetzt. Ich renne zur Nagelschere und weine noch heftiger, um mich und weil ich nicht anhalten kann. Wahlwiederholung. Besetzt. Überlege mich selbst einzuweisen, schaff es aber nicht, weiß auch wie es dort ist, und will dort nicht hin. Wohin mit mir?
Irgendwann das Freizeichen, sie klingt atemlos, „Hallo?“ Schluchzen, Stottern, ich hasse mich so, Mama, ich kann das alles so nicht mehr leben. Mama hört zu, Mama fragt, Mama erzählt. Mama kennt. Und ist doch ebenso überrascht wie ich selbst. Noch während wir sprechen packe ich meine Sachen wieder aus. Hau nicht ab wie sonst.
Zwei Stunden später kann ich aufhören zu weinen. Es ist wie runterkommen von einem krassen Crystaltrip. Die Welle zieht sich zurück ins Meer, der Wind flacht ab, Möwen kreischen. Es bleiben Staunen über das uralte angespülte Strandgut, Entsetzen. Ratlosigkeit. Erschöpfung und somit endlich so etwas wie Ruhe. Aber ich weiß, diese Flut kommt wieder.
Seelenheil ~
... link
okavanga, 17:24h
Eigndlich bassd gor nix.
Seelenheil ~
... link
... older stories